
 |
| Home |
Dorf | Kirche St. Idda | Schule / Freizeit | Pflanzen / Tiere | Stimmungsbilder |
| Ereignisse | Dampfschiffe / Urnersee | Umgebung | Früher | Uri Spezial | Bauen Tourismus |
| Beschreibung
von Klausenpass und Urnerboden für Wort- und
Bildgeniesser Diesen Sommer hatten wir die Gelegenheit, den wild-romantischen Klausenpass und vor allem den weitläufigen Urnerboden zu geniessen. Später erhielt ich ein altes Buch mit der genauen Beschreibung des Passes und der dazugehörenden imposanten Gebirswelt, auch über die Geschichte dieses historisch so bedeutenden Tales. Und so verbinde ich 1900 mit 2007, ein alter, weitschweifender, blumig erzählter aber noch gültiger Text garniert mit neuen Bildern. Der Text muss jedem gefallen, der nicht nur so schnell wie möglich von A nach Z lesen will, so wie Autofahrer am Klausenpass-Memorial-Rennen, die möglichst schnell von A nach B düsen. Über den Klausen Auf neuer Gebirgsstrasse zwischen Ur- und Ost-Schweiz Von Prof. F. Becker Im Auftrag der h. Regierungen von Uri und Glarus herausgegeben vom Verkehrsverein für den Kanton Glarus Glarus 1900 Im Kommissionsverlag von Bäschlin's Buchhandlung "Nicht weit ausser dem Flecken Altdorf zweigt die Klausenstrasse von der Gotthardstrasse ab. Rechts in einer Wiese steht ein stattliches Gebäude, das urnerische Zeughaus, das frühere Korn- und Salzhaus, wo die Landesregierung väterlich für die Ernährung der Bürger in guten und bösen Zeiten sorgte; vom nahe gelegenen Richtplatz, wo die Gerichte die armen Sünder straften, sind die Spuren verschwunden. Wir versinken wieder in alte Zeiten, nur die Mauern an der Strasse, an denen noch kein Epheu rankt, erinnern uns wieder ans Neue. Bald zeigt sich Bürglen, die Geburtsstätte Tells, trutzig und zugleich lachend auf einen Hügel gebaut. Ist das eine Wehre oder eine Einladung zum Eintritt ins Thal? Ein finsterer Turm steht neben der Kirche, zugleich aber auch ein freundliches Gasthaus; wir dürfens also wagen."  "Wir treten
an den von der Poesie verherrlichten Schächen. Ja, der schafft
ja ganz prosaisch, trägt Hölzer aus dem Thal und
sägt und spaltet sie; weiter oben treibt er sogar ein
Elektrizitätswerk. Ist das der Schächen? Ja, denn das
sagt uns ein Denkmal an der Brücke zur Erinnerung an Tells Tod
und ein Spruch drauf von Uhland:
Weithin wird Lob gesungen, wie du das Land befreit; Von grosser Dichter Zungen, vernimmt's noch späte Zeit; Doch steigt am Schächen nieder, ein Hirt im Abendrot, Dann hallt im Felsthal wieder, das Lied von deinem Tod. Gott
grüss dich Schächen! In einem Bogen führt
uns die Strasse auf den Dorfplatz; da steht auch ein Telldenkmal, mit
einem Knaben aber, der nicht schuld daran ist, dass er ins
Geschichtsbuch gekommen. Bei der Kirche am alten Weg erblicken wir eine
kleine Kapelle; hier soll Tells Haus gestanden sein. Von der Terrasse
des Kirchhofes thun wir eine Blick ins weite Reussthal; die
Äbtissinnen des Fraumünsters, die einst hier ihre
Meierwohnung hatten, wussten auch, wo es schön sei und wo man
so recht thronen und ins beherrschte Land hinaus schauen konnte. Nicht
umsonst weilte im herrlichen Bürglen oft und gerne auch der
verstorbene Bayerkönig Ludwig II.
Im alten
Meierturm haben die Urner ihr historisches Museum angelegt; wenn man
von den Bildern der Landammänner sagen kann, wie der Regent,
so das Volk, so muss man von diesem keine üble Meinung
bekommen. Ein Bild in ein Museum hinein, wenn dieses gross genug
wäre, ist auch das schöne Haus des Landammanns und
Ritters Peter Gisler aus dem Jahr 1609 oben im Dorf, mit seinem
gemauerten Erdgeschoss und den Ringen zum Anbinden der Rosse, mit dem
brauen Holzbau darüber, den Vordächern ob den
Fenstern mit den Buzenscheiben und dem Hochgiebel.
Die Strasse führt uns ins Thal hinein, das seinen intimen Reiz zu entfalten beginnt - will heissen, in dem uns recht heimelig wird. Ist der Blick thalauswärts an den Gitschen, Blacken und Krönte mit den riesigen Formen, wild und gewaltig, so erscheint das Thal vor uns lieblich und zahm; wie gehen einem Idyll entgegen, die malerischen Veduten und Stimmungsbilder drängen sich. Man kann das Schächenthal noch geniessen, durch das uns keine Eisenbahn im Fluge trägt und uns kaum naschen lässt an den Schönheiten."  "Rechts
öffnet sich das Riederthal, wo die Frauen hineingehen, um
Kindersegen zu beten; von links herunter schaut der Kinzigkulm,
über dessen Hänge und Grat die Russen anno 1799 ihre
Kanonen geschleppt, nachdem sie den Gotthard bezwungen, aber am See
ihren Halt gefunden und sich neuerdings in die Berge schlagen mussten.
Da hätte auch manche Mutter um ihren Sohn gebetet, wenn sie
gewusst hätte, in welcher Gefahr er steht.
Um die Strassenecke erscheint Loreto, die fensterlose, kaum vom Dachraum etwas erleuchtete Kapelle des Büssers und des Weltscheuen; haben wir auf unserer kurzen Wanderung schon zuviel der Sonne und der Freude gesogen? Durch ein vor die Kapelle gebautes modernes Wirtshaus ist die Stimmung des Ortes verdorben - ob man sich da vielleicht wieder erholen möge vom Träumen und Härmen im Halbdunkel? Dann senkt sich die Strasse zum Bache, um diesen zu überschreiten und ihm zu folgen, in der Tiefe, damit man nicht zu sehr schwelge in den Fernsichten. Wir betrachten die Wanderer: da kommt ein junges Paar, unter einem Sonnenschirm; die haben Sicht nach innen und sehen nur, dass alles blau ist. Andere Gedanken bewegen den Bändelkrämer mit seiner Last, der langsam daher schreitet, den noch nicht gemachten Tagesgewinn überschlagend. Dann folgt der Pfarrherr mit seinem roten Buch, aus dem er ewige Weisheit liest; hinter dem Haus hervor schiesst der "Spitz" oder "Schnauz" und stört ihn auf aus seinem Sinnen. Und an allen vorbei, Poesie und Philosophie, radelt eilig der Radler, vor sich die Lenkstange und die Geleise der Strasse. Hinter den Häusern von Brügg betreten wir eine Brücke, eine feste, neue; neben ihr duckt sich die alte, in Epheu gehüllt. Ob wohl über die neue auch einmal so weit hergekommene Krieger ziehen werden, wie über sie? frägt sie sich und uns. Wer weiss? die Klausenstrasse ist auch eine Militärstrasse, aber nicht gebaut, um fremden Heeren den Durchzug zu öffnen, sonder zu wehren."  "Niemand zur Freud und niemand zu Leid haben wir im Innern der Schweiz, am Gotthard und im Reussthal, Werke der Sicherung und Erhaltung unseres Landes in Kriegszeiten angelegt, Festungen, Verpflegs- und Munitionsmagazine. Da, im Herzen des Landes, können wir, wenn es an den Fronten bedrohlich wird, Kriegsmittel sammeln und sichern, um die Armee, die draussen im Lande kämpft, zu unterstützen, und ihr einen Rückhalt zu bieten. Je freier wir uns im Lande bewegen können, von und zu dem Landes-Innern mit seinen Hülfsmitteln und Reserven, desto freier und kräftiger können wir auch unsere Streitkräfte draussen verwenden und da erhöht nun eben gerade die neue Klausenstrasse diese freie Bewegung in hohem Masse. Ihr Bau wurde daher vom Bunde mit so grossartigen Mitteln unterstützt und gefördert, zur Stärkung unserer Landesverteidigung. Die Schweizer glauben nicht, dass man sich zum Kampfe einschliessen müsse in enge Wege, in ein enges Kleid. Das Kleid muss weit sein und bequem, dass man sich bewegen kann und bewegen will sich der Schweizer in künftigen Kriegen so gut, wie in den vergangenen."  "In den
letzten Septembertagen des Jahres 1799 zog durchs Schächenthal
hinein ein russisches Heer von 20 000 Mann. Suworoff, der Sieger von
Italien, war unter schweren Kämpfen über den Gotthard
herbeigeeilt, um nach Zürich zu ziehen, wo er sich mit einem
andern russischen General, Korsakoff, vereinigen sollte, um gemeinsam
die französische Macht unter Masséna zu schlagen.
Er fand aber bei Flüelen, wo er glaube, einen Weg
längs des Sees oder Schiffe zu finden, weder Weg noch Schiff,
dagegen feindliche Truppen. Er will aber absolut nach Schwiz und von
dort nach Zürich und so bleibt ihm nichts anderes
übrig, als ins Schächenthal abzubiegen, den
Kinzigkulmpass zu überschreiten und durch das Muotathal nach
Schwiz vorzudringen. 3 Tage lang kamen aus dem Hürlithal
heraus zum Erstaunen und Entsetzen der Muotathaler die fremden Krieger.
Aber auch nach Schwiz hinaus war der Weg gesperrt. Nach
fürchterlichen Kämpfen um die Brücke
über die wilde Muotaschlucht mussten die Russen
zurück, wieder einem Bergpass, dem Pragel, zu. Aus dem
Klön- und Linththal endlich hofften sie nach dem
Zürichsee vorbrechen zu können. Vergebliche Hoffnung!
Auch dort stehen die Franken und wehren den Ausgang.
Erschöpft, dem Hungerstode nahe, bestürzt von der
Niederlage Korsakoffs bei Zürich, verzweifelt, aber immer noch
nicht gewillt zur Übergabe, wenden sich die Russen nach dem
Sernfthal, um am 5. Oktober bei schlimmer Witterung,
Schneegestöber und Nebel noch den wildesten, den über
2400 m hohen Panixerpass zu überschreiten. Da waren sie
endlich der Franzosen los und über Chur und Feldkirch zogen
sie nach Östreich. Noch viele Jahre nachher fand man in den
Schründen des Panixerpasses ganze Haufen menschlicher
Knochen."
 "Auch der
Klausenberg hatte in jenen Zeiten seine Schrecken gesehen. Im Laufe des
Sommers von den Östreichern mehrfach besetzt, bald unter
Beihilfe der Glarner, bald der Urner, erfolgte am 18ten August ein
Angriff der Franken von den Hängen ob der Balmwand her, der
vom Nebel begünstigt, die Verteidiger überraschte, so
dass sie nach erheblichen Verlusten sich zurückziehen mussten.
Die Franzosen folgten ihnen bis auf den Urnerboden, um sie dann am 30.
August bis nach Linthal hinunter zu treiben.
Doch wir schreiten vorwärts am Schächen, der friedlich neben uns vorbei rauscht, nicht zu schleichen und nicht zu zerschellen braucht; es geht so schön abwärts und er hat nichts zu tragen; es ist ihm gerade so recht wohl zum leer laufen. Freilich, wenn es drinnen im Thale wettert, dann stäubt und dröhnt er und wälzt seine Blöcke und dickbraunen Schwälle hinaus, dass der Boden erzittert. Das Thal weitet sich wieder; hoch oben erscheinen die Hörner der Windgälle mit dem Älplerthor, an den Hängen die Berghäuser die Einzelsitze der alten Alamannen, die heute noch Niemand über sich haben als den zackigen Grat und den Himmel, die noch ungefähr so ungeschoren bleiben von einer Obrigkeit wie zur Zeit der Herzoge und Äbtissinnen, die aber gleich trotzig ihr Haupt erheben würden, wenn ein Gessler sie plagen wollte. Altdorf ist weit und Bern noch weiter und nur etwa das eidgenössische Dienstbüchli mahnt an den Regenten. Da wohnte einst der Hartolf und der Trudilo, der Gunthart und der Merkilo, heute der Joder und der Alowis, der Toni und der Sepp. In Trudelingen steht noch mitten in den grauen und braunen Holzhäusern das alte Steinhaus, die "Zefelhofstatt", das Wohnhaus eines ehemaligen vornehmen Urners; so mögen auch die vornehmen Alamannen gewohnt und unter den breiten Bogenfenstern ins Thal hinaus oder an die Clariden hinaufgeschaut haben, wenn sich die Wolken zum Gewitter ballten. Hier ahnen wir nun auch, da wir die Gletscher sehen, dass es ins Hochthal hineingeht; noch winkt der rothe Thurm von Spiringen hoch an der Berglehne und sagt, dass wir noch Weile haben, bis wir an den Firnen sind. Rechts erscheint die Pyramide der Spitzen, während rückwärts die Gitschen-Urirostockwand den Gesichtsraum einnimmt und die Perspektive schliesst. Das Thal erscheint mit weit offenen Flanken, aber ohne Sohle. In der Wiese neben dem Haus bindet die Schächenthalerin, den breiten Strohhut auf dem glattgekämmten Haupt, das trockene Heu; mit eiligem Gruss schreitet der hemdärmelige Mann mit seinem "Raschi" (Tragkorb) am Rücken und dem Krummstock in der Hand an ihr vorbei, er will noch "über den Berg". Die Strasse mit ihren hohen Stützmauern an der "Schrottengass" beginnt den Charakter der Gebirgsstrasse merken zu lassen."  "Witerschwanden
erscheint, ein kleines Gemälde des Friedens für sich;
der Sägebach zieht sein weisses Band über den dunkeln
Felsen in grüner Trift und drüber hinaus blaut die
Lücke des Kinzigkulms, so friedlich, als ob dort nur
Geissbuben und Geissen durchgezogen und nie keine Kosaken.
Gegenüber zeigt uns der Hang des Berges, wie daran der
Thalfluss seine Arbeit verrichtet, den Fuss des Berges anfrisst und das
heruntergerutschte immerwährend fortschafft. Dann treten wir
ein in eine schon ganz alpine Scene; das Thal scheint abgeschlossen
durch einen Riegel, über den herunter der Bach kollert, im
breiten steinigen Bett; der Laubwald verschwindet, Alpenwald hebt
düster seine Wipfel, keine menschlichen Wohnungen mehr, nur
noch ein bescheidenes Hüttchen am Ausgang einer finstern
Schlucht, im Mittelgrund der Felssturz der Spitzen und zum erstenmal in
der Ferne, die weissen Firnen der Clariden und die eine Scheerenspitze
des Scheerhorns. Thalauswärts ist die Coulisse geschlossen,
der Blick ins Reussthal abgeschnitten. Da, eine Wendung der Strasse,
und wir sind wieder im Laubwald, beim Bergahorn am grünen
Hang, dem Wahrzeichen des obern Schächenthals. Noch ein paar
Schritte weiter und uns winkt wieder, diesmal näher, der
spitze Thurm von Spiringen.
Welch ein ausgesuchtes Bild! Es scheint, als ob ein Comité von Malern die Häuschen und Bäume ausgesucht und zusammengestellt hätte, um eine schöne Gruppierung zu bekommen und mit dem Samtbraun der Häuser in hell leuchtendem Grün Farbenkontraste zu wecken. Die Abendsonne scheint ins Thal und legt ihr Licht auf den einen, den duftigen Schattenmantel über den andern Hang; tiefblau der Himmel und golden die Wolken am Firn; kühl streicht die Abendluft über die Wiesen oder spielt leise in den Blättern des Ahorns. In der Tiefe murmelt der Schächen sein Abendlied, in das das Glöcklein der Kirche einfällt, um die Frauen und Mädchen zum Abendsegen zu rufen. Still gleitet die Sonnenscheibe hinter den fernen Bergen herauf, Abend im Hochthal will es werden; man möchte beten und mit der Natur schlafen gehen. ... Gute Nacht Spiringen."  "Aber nicht
schläft oder rastet die Natur, das weist uns der Felssturz der
Spitzen. Da stürzten vor Jahren (1887) die Felsen herunter und
erfüllten das Thal mit Donner und Rauch; eine Totentafel nennt
uns die Namen von sieben Verschütteten. Wohl ist es jetzt
ruhiger am Hang, aber "brosmä tuet äs eister no". Die
Brosamen, die da "immer noch" herunterbröckeln, sind aber nach
dem Klafter zu messen. Solche breite Wunden schliessen sich nicht so
schnell; Rüfen fahren ab und häufen ihre Schuttmassen
auf, die dann der Schächen thalauswärts verfrachten
soll. Der Berg arbeitet sich ab, keine Menschenhand wirkt ihm entgegen.
Das Gold über den Clariden wird zu Glut und Purpur, während es im Thale dämmert; wir ziehen fürbas die Strasse, hoch über dem Schächen. Weit oben am Berge steigt ein blaues Räuchlein aus der Hütte und auf den Stein über der Felswand hinaus tritt der Senne, den Alpsegen zu rufen: "Bhüets Gott und der lieb heilig Sant Jöri, dass er wohl ufwachi und höri". Mählig wird es auch in der Höhe bleich und grau; mit dem Verschwinden des Rot in den Wolken ist auf einmal auch das Blau des Himmels gewichen; grünlich weiss ist das Gewölk, das Mondlicht spielt schon darin. Dann färbt noch einmal ein lichtes Rosa den Himmel; die Windgälle reckt ihr Haupt hoch in den Äther, wie um noch suchend nach der Sonne auszuschauen. Noch einmal leuchtet der Himmel ins dämmernde Thal, wiederum erhellen die Wolken in freundlichem Licht, ein letztes Aufschlagen der Augen; das ist der Gruss des scheidenden Tagen."  "Aus dem
Halbdunkel hebt sich noch im Thalhintergrund der Silberfaden des
"Stäubi", wo die Gletschermilch herabquillt ins lauwarme Thal;
darüber winkt die Passhöhe des Klausen und
drüben wieder ein neuer Tag des Schauens und der Freude.
Die Strasse senkt sich in den Thalgrund, Lichter blinken uns entgegen; wir sind in Unterschächen. "Capo dolcino" würden die Italiener diesen friedliche Boden nennen. Ganz so friedlich mags zwar hier nicht immer sein, wo zwei Bergwasser zusammenrauschen. Die Kirche mit dem Friedhof und dem Beinhaus hat sich weislich auf einen Hügel geflüchtet, nicht blos weil es da schöner ist, ins Thal zu schauen, sonder auch sicherer und der Ruhe zuträglicher. Weiss glänzt sie im Mondenschein, aber noch weisser erstrahlt der Firn drinnen im Brunnithal; wie das ewige Licht hängt der Mond über diesem mächtigen Raum, der grössten Kirche der Alpe. Der Eingang ist offen, nicht sperrt eine finstere Schlucht; schwermütig singen die Bäche, wie Harfengetön erklingts in den Felsen, der Föhn spielt um die Säulen, Mitternachtmette hält die Natur.... Morgen wird's; rothgolden zündet die Thalfackel, der Gitschen, ins Thal; dann leuchtet ein Horn ums andere in der Frühsonne auf. Wir gedenken noch ein Weilchen im Schatten zu wandern; aber bald erscheint das Tagesgestirn über der Lücke des Klausen und schüttet sein Gold in den Grund, der Sonne entrinnen wir nicht in diesem Thale. Mit dem alten Mütterlein steigen wir noch zum Kirchhügel auf, in der Nische der Kapelle sitzt ein blinder Beter; der findet den Weg nicht nur da hinauf, sondern auch noch über die Alpen, über die er in der Jugend gezogen und jährlich hinaus zur Landgemeinde, an der er nie fehlt. Seine Bilder, die er schaut, sind wohl nicht die vom Fegfeuer und den sieben Todsünden an der Wand der Kapelle, sondern Sonnenschein auf der Alp und ein lieblicher Himmel, nach dem er sich sehnt.... Auch wir wollen hinaus aus der engen Kapelle, hinaus ins Leben, an die Sonne, in die Höhe!"  "Wir sind
immer noch im Thal; einmal soll's nun aufwärts gehen; wir
lassen uns noch erzählen vom alten Bad im Brunnithal, wo man
durch eine Höhle hineinkriechen musste, um zur Heilquelle zu
kommen und in ein grosses Kessi zu tauchen, das später die
Regierung wieder hervorholte, um Kupfermünzen draus zu
schlagen. Heute kriechen die Sommergäste von
Unterschächen nicht mehr in eine finstere Höhle, um
drin zu gesunden; sie baden sich im herrlichen Sonnenschein und in der
reinen Luft und das bekommt ihnen gar prächtig.
Am patriarchalischen Posthaus ohne Säulen und ohne Turm vorbei schreiten wir thaleinwärts; es zieht uns förmlich nach oben. Im Thalhintergrund liegt ein Ton wie verdichtetes Himmelblau; thaufrisch ist die Luft. Wir dringen aber nicht zu weit ein in diesen Duft; bald wendet sich die Strasse auswärts dem Licht zu. Wir fragen uns, warum wendet die Strasse wieder, warum begann sie nicht schon hinter Spiringen den Berghang zu gewinnen, anstatt sich noch einmal nach Unterschächen hinein zu senken? Warte nur! Die ersten Verbauungen erscheinen und erinnern uns an die Tücken des Berges; dann ein Bach, eine Krümmung und stolz steigt aus der Öffnung des Brunnithals die grosse Windgälle. Ein leichtes Föhnwölkchen steht über ihrem Haupt, wie der Berggeist, der sagen wollte; mir nahest du nicht! An der Strasse steht ein Ingenieur und hat sein Fernrohr nach ihrem Gipfel gerichtet. Solls eine Bergbahn geben? Strassen sind recht, aber Bahnen überall brauchen wir nicht, sonst müssten wir einmal Schonreviere in den Alpen einführen, wo niemand herein darf, kein Messknecht noch Photograph und Ansichtskartenzeichner, sondern nur noch der empfindende, sinnende Mensch."
"Nach der
grossen Windgälle erscheint der grosse Ruche, gross ist hier
alles in diesem Brunnithale. Aus dem Lande herein schaut wieder der
Urirotstock, die Hochwarte der Urschweiz. Immer höher steigt
die Strasse, aber mit ihrem Steigen heben sich auch die Gipfel;
thalauswärts blicken wir in die offene Welt,
thaleinwärts ans Ende der Welt; tief unten zieht der
Schächen sein milchblaues Band durch den Grund. Jetzt
verstehen wir die Anlage der Strasse; die hat hier nicht der Ingenieur
noch der Stratege gebaut, sonder der Maler. Das ist mit der Steigerung
seiner Ausblicke ein wunderbarer Bogen, der uns die
Schönheiten der Gebirgswelt mit ihren Innenräumen
auskosten lässt. Ehrlich gesprochen waren es zwar die
fürsorglichen Ländesväter, die es so haben
wollten, nicht rein aus ästhetischen Motiven, die Ingenieure
hätten es lieber anders gemacht, aber wir müssen es
ihnen doch danken, dass sie die Klausenwanderer zwingen, angesichts der
immer gewaltiger sich entfaltenden Hochwelt diesen "Bogen der
Beschauung" zu machen. Wie da bald in der Form die Silhouetten, bald in
der Farbe die Töne wechseln und sich überbieten!
He höher in der reinen Luft, desto schöner braun stehen die Häuschen an den grünen Ecken. Auf der einen Seite erscheinen zunächst noch unscheinbar, die zwei gekreuzten Zacken des Scheerhorns wieder, man ahnt, dass aus ihnen noch etwas anderes wird, auf der andern zünden über die grünen Planken herab die weissen Kalkriffe der Schächenthalerwindgälle und der Märenberge, die uns nicht mehr verlassen bis ins Linththal hinüber. Ein Blick an den Bergsturz der Spitzen öffnet uns einen Blick in den Werdeprozess des Thales. Eine neue Wendung der Strasse, wir sind in Urigen. Wieder erscheint eine Kapelle am Hang, der noch saftig grün, nach oben in den Farben der Alp ausgeht, ins gelbrote spielt und zuletzt im weissblauen der Felsen endet. Die Welt weitet sich, mitten drin, um sie vollkommen zu machen, stellt sich wieder ein Wirtshaus, das Posthaus, diesmal ferner von der Kapelle, um ihr nicht den Reiz zu nehmen, es sind beide an ihrem Ort. Wir thun die paar Schritte über den Teppich hinaus; wie Theaterscenerien verschieben sich die Bilder, mächtige Bäume bilden die Coulissen, man steht still, ist das gesehene das Schönste oder wird es noch schöner? Alles nur Licht und Farbenlust. Wir vergessen Felssturz und Bergschutt, die bilden jetzt nur das warme blattgrau, das mit dem grünen contrastiert und es hebt und sättigt. Gewiss, wenn der Herrgott über dem Gotthard drüben den Himmel gemalt hat, hier malte er die Erde. Wir treten in die stille Bergkapelle; die birgt einen Schatz, ein herrliches Gemälde, um das sie manche stolze Bischofskirche beneiden dürfte. Ein alter Condottiere, Azarias Pünthener, liess da durch einen berühmten Maler aus der Bologneserschule, den Flamänder Denys Calvaert, gennnt Flaminggo, eine köstliche Pieta malen und stiftete sie der Kapelle. Wer sollte ein solches Bild hier oben suchen?"  "In der
Sonne wandern wir wieder bergwärts, das Scheerhorn
enthüllt sich immer mehr, ihm reihen sich an Kammlistock und
Claridenstock, die Teufelshörner und der Bocktschingel mit
seinem Felsenfenster. Die Strasse führt uns weiter in der
leuchtenden Höhe. O, dass wir allen diesen Farbenglanz in die
Bilder unseres Büchleins legen könnten! da ist auch
die schönste "Photographie" nur ein bescheidener Klavierauszug
der in allen Tönen rauschenden Symphonie.
Wohl sagen die Linien des Bildes dem Künstler, was diese Züge bedeuten, er ahnt hinter seinen Tönen die Macht und Gewalt der ganzen Musik; dem einfachen Beschauer aber wird es nur eine Photographie sein, ein Klavierstück wie ein anderes. Kommet und höret auch die ganze Musik, schauet die Natur in der Schönheit ihrer Wirklichkeit!"  "In
leichter Steigung windet sich die Strasse aufwärts durch die
Güter mit ihren freundlichen Häuschen und
Hüttchen; wir vergessen, dass wir der Hochwelt, die wir vor
unsern Augen aufsteigen sahen, immer mehr uns nähern. Der Fels
tritt zurück, die Wehrsteine und Dohlendeckel der Strasse sind
aus Cement erstellt, ein Gebirge in dem man nicht einmal Steine findet!
Steine wohl, aber keine soliden; sie verwittern zu leicht, darum diese
schönen Wiesen am Hang. "Faul wie Felsen" sagt nicht umsonst
der Urner.
Unter uns liegt immer noch Unterschächen, dass wir es ja nicht vergessen; über uns dreht sich das Scheerhorn immer mehr, bis es zuletzt seine ganze Breitseite weist. Noch immer gleich fern oder in der steigenden Sonne noch ferner erscheint die Balm und links drob das Märcherstöckli, der Wachtturm des Klausen; doch sind wir ihnen in der Höhe näher. Darüber weg legt sich der breite Rücken des Langfirns, jenseits eines Beckens, das wir nur ahnen können. Fast achten wir unten in der Tiefe das friedliche Aesch nicht, mit seinem Hüttendörfchen, wo einstmals nur ein Tannenreis auf dem First eines Hüttchens meldete, dass man auf Begehr Labung finde, heute aber ein Gasthaus steht und trauernd zu der neuen Strasse aufsieht. Der Circus der Balmwand schliesst das Thal in der Tiefe; aus dem bewaldeten Felsen schiesst der Stäubi. Lustig wirft der Bach seine Raketen in die Luft, das ist kein furchtsames Hinabfallen, kein Schleichen über einen Felsrücken, kein unheimliches Tosen in einer finstern Schlucht, dass man nicht weiss, sind Kröten drin oder Drachen; der kommt aus der Höhe, frisch vom Gletscher weg, springt singend, tanzend über die Felswand hinaus, und steht unten schnell wieder auf und eilt fort über Stock und Stein eine stotzige Halde hinunter weiter das Thal hinaus. Sinnend wandern wir dahin, der hellbeschienenen Strasse nach; blicken wir seitwärts, so erschrecken wir fast ob dem brennenden Grün und dem Tiefblau."  "Noch ein
riesiger Ahorn über dem brauen Stall ob der Mauer, dann
verlässt uns der Laubwald, über den zerstreuten
Häusern der Schwanderberge und Windeggen grüsst der
Alpenwald; hoch oben klebt noch ein Haus im Schutz dunkler Tannen, hart
darunter reisst im Winter die Lawine an. Wenige Schritte noch, und wir
treten aus der grünen Welt in die graue der Felsen, von der
Bergstrasse zur Gebirgsstrasse, aus dem Hang in die offenen Gallerien
des Seelithals.
Das sind nicht nur düstere in Fels gesprengte Löcher, es ist eine Gallerie herrlicher Bilder, geschlossener Ausblicke durch die Seitenöffnungen hinaus an den gegenüberliegenden Thalhang, auf den Stäubi mit dem Clarideenstock, Scheerhorn und Windgälle."  "Durch
dieses Thor sind wir aus der Bergweide in die Alp getreten;
Rüfen und Riesen dehnen sich, magere Grotzen lugen
über das Strassenbord herauf. Hoch oben in den Felsen rupft
das Geissbäuerlein das Futter für seine Ziegen;
eintönig klopft der Tengelhammer, die Sichel zu
schärfen; in alles hinein ruft der Geissbub, den es
däucht, es habe es Niemand so schön wie er, seine
Jauchzer. Endlich bleibt auch der Wald zurück oder streckt nur
noch seine zerschlagenen Stumpen in die Luft; Felsplatten richten sich
auf und Sturzbäche rieseln in Regenbogenfarben hernieder;
mächtig rauscht es vom Stäubi herauf, dumpf vom obern
im Felsen verborgenen Falle herüber. Ich grüsse
hinüber nach der Kammlialp, wo ich einst ein
Römergesicht gesehen, dessen Mutter, eine Sennerin von den
Schwanderbergen, wohl viel vor dem Bilde Flamingos in der
Götschwilerkapelle gebetet - . Doch um die Felsecke biegen
Touristen und wecken mich aus dem Sinnen. Ob die wohl auch so
schöne Bergeserinnerungen aus dem Herzen graben
können wie der weiland Topograph? der eins als
Jüngling den Bergen sein Leben geweiht, dort am Abend nach
gethaner Arbeit vor dem Hüttchen sitzend, das ihm Labung und
Ruhe verhiess, hinaus schaute ins Weite, unter ihm eine Welt,
über ihm eine Welt und vor ihm eine.
Höher steigt die Sonne, immer heisser geben sie die Felsen wieder, der alte Weg, die Balmwand hinauf, liegt noch im Schatten; kühl ist's da drunten und in Aesch läutet das Glöcklein Mittag. Aber auch bald weht es kühler vom Klausen her und auf der Balm winkt uns Labung. Wie vor grauen Zeiten ist aus den nordischen Wäldern eine alamannische Familie gekommen und hat sich angesiedelt, zunächst am See, dann im Thal und zuletzt auch auf dem Berge, und bietet uns Zehrung. Wir biegen ein in die Balmalp; friedlich grasen die Kühe im grünen Boden; von allen Seiten laufen die Quellbäche zusammen, um dann geeint ein Silberband über den Felsen zu zeihen. Draussen über dem Zaun, wo das Vieh nicht mehr hin darf, mähen die Wildheuer das würzige Gras. Rings um die Alp schliessen sich die Felsen immer mehr zum Gürtel und drüber die Firnen zum Kranz, aus denen das Scheerhorn als Diadem leuchtet. Auch hier müssen wir im Ingenieur den Maler loben; in einer Kehre führt er uns herum, dass wir das alles auch gründlich geniessen. Maler der Alpen, kommt her und sättigt eure Paletten. Dichter greift in die Seiten, Geologen forschet in der grossen Werkstätte und im grossen Ruhefeld der Natur, Volkswirte schauet das Leben der Alp, Botaniker pflücket Blumen, Clubisten klettert, Bergfreunde geniesset, alle freuet Euch!" 
"Leicht
ansteigend führt uns die Strasse dem Passe zu. Immer stiller
wird's; das Herdengeläute ist verstummt, alles ist so
feierlich, nur der Wegknecht an der Strasse sagt uns, dass es nicht
Sonntag ist. Im Frieden der Hochalp wandern wir bergan; von den Steinen
neben der Strasse grüsst uns die Alpenrose; nur etwa bei einem
Windzug hören wir von Zeit zu Zeit das Rauschen der
Bäche, aber kein Poltern und Donnern mehr. Wir haben den
Schächen verloren, der seine Wasserfülle an den
Firnfeldern des Scheerhorns sucht und nicht im friedlichen
Thälchen des Klausen. Wer mit den Stimmen der Natur vertraut
ist, hört etwa einen Knall; das ist der Firn, der sich
spaltet; dann zwischen hinein ein Krachen; vom kirchturmhohen Rande des
Gletschers lösen sich schwere Tafeln und zerschellen und
zerstieben über die Felsen."
Der magere brauen Rasen ist durchsetzt von weissen Karren, darüber flattert in kurzem Fluge das Schneehuhn; in den Köchern liegt noch Schnee und vor seinem Baue das graue Murmeltier..."
"Blendend
weiss ist die Strasse; da auf einmal rötet sich der Boden.
Haben die Urner einmal in einem frommen Eifer ihren "Italiener" hier
ausgeschüttet? Weisse Strasse, weinroter Boden, eine
grüne Kruste darauf, dahinter der graue Berg und
drüber der blaue Himmel, welch wunderliches Farbenspiel?"
Urnerboden Korporation Uri "Am roten Felsen erkennen wir, dass wir der Passhöhe nahen und richtig; sie ists; da steht noch, nein es steht nicht mehr, das Klausenchäppeli, dafür ein neu errichtetes Schirmhäuschen, und darüber erhebt sich das Wahrzeichen, der Wächter an der Landesmarch, nein auch nicht, nur an der Grenze zwischen Reuss- und Linthgebiet, das Märcherstöckli. Salve Klausen!"  "Keine
grosse Geschichte hat dieser Berg, man weiss nicht viel von ihm und
wagt nicht einmal seinen Namen zu deuten. "Glöusä"
sagt der Urner, "Chlausä" der Glarner; ein "Glausen" gibt's
auch im Maderanerthal. Soll im Namen Klausen für einen so
offenen Bergübergang das Wort Clausa stecken? Das stimmte
für den weiter unten gelegenen, geschlossenen Kessel, der
"Klus" genannt wird, schon besser; oder kommt er von St. Niclaus her?
dann wäre wohl auch das "Sämi-Klausen" doch erhalten,
wie es sonst überall der Fall ist. Von einem
"Chäppeli", das da oben stund, will Niemand etwas wissen; wie
es auch anderswo vorkommt, erhielt ein einfaches
Schirmhäuschen, in dem etwa ein Heiligenbild
aufgehängt wurde, den Namen Chäppeli."
 "Der
Klausen als Pass wird so alt sein wie die Besiedelung resp.
Bewirtschaftung des Urnerbodens, oder der "Ennetmärch", wie
die Urner sagen, vom Schächenthal her. Die Alpweiden ziehen
sich von den Schächenthalerbergen ununterbrochen über
die Klausenhöhe hinunter ins Thal des Fätschbaches;
den Pass fanden auch die weidenden Kühe. In die Geschichte
tritt der Pass mit dem Zeitpunkt, wo auch der Urnerboden auftritt und
da dürfen wir hinabgehen bis in die Zeiten der Kämpfe
zwischen den Alamannen und Walen. Dass seither das Leben auf dem
Urnerboden sich nicht wesentlich geändert hat, und wohl erst
mit dem Bau der Strasse ändern wird, werden wir weiter unten
sehen."
 "Doch wir
rasten nicht zu lange auf der Passscheide, wir wollen
vorwärts, neuem Schauen entgegen. Die Firne starten nicht hoch
über dem Pass, da müssen auch wir hoch sein. Nur 1952
m über Meer sagt uns die Karte und doch stehen wir mitten in
der Hochwelt. Das ist das charakteristische vom Klausenpass, dass er
mit einem verhältnismässig tiefen
Passübergang, nur der Lukmanier ist noch um etwas niedriger,
doch so sehr eindringt in diese Hochwelt und uns das ganze Wesen
derselben enthüllt; er muss daher der bevorzugte Pass werden
für alle diejenigen, welche ohne die eigentlichen
Mühsale der Gebirgswelt auf sich zu nehmen, doch ein
vollständiges Bild derselben geniessen wollen."
 "Unser
Blick wendet sich nach Osten; da fesseln ihn zunächst die
Kalkstöcke der Märenberge bis hinaus zum Ortstock,
die uns als alte Bekannte erscheinen; ihnen vorgelagert ist eine
schmale Stufe, wo das Grün der Weide mit dem Grau der
Schutthalden ringt; dann liegt zu Füssen ein sanftes offenes
Thal, die grösste und schönste Alp des
Schweizerlandes, ein Gebiet, um das man sich wohl streiten durfte.
Rechts ist das Thal dunkel umsäumt vom Wängiswald.
Darüber hinaus blauen die Glarnerberge mit dem
Kärpfstock in der Mitte, der mit seinem leicht
geröteten Haupt und der weissen Halskrause wie ein
Thalratsherr in seinen Freibergen tront und über die Gemsen
wacht, die seit mehr als drei Jahrhunderten landesobrigkeitlichen
Schutz geniessen."
 "Wie sie
sich gehoben, senkt sich die Strasse, sanft, stetig; wir glauben bald
im ebenen Boden unten zu sein. Da erscheinen Ränke und
merkwürdig verschlungene Kehren. Fängt die
Gebirgsstrasse erst an? Aus der Tiefe tauchen glatte Felsen aus einem
noch verbogenen Thal; darüber dehnen sich graue Schutthalden
und zerrissene Gletscher. Verwundert schauen wir zu der gefurchten
Stirn des Clariden auf, müssen wir etwa in das Gletscherthal
eindringen? Richtig, die Strasse windet sich hinein in das Thal, aber
sie stösst nicht an den Firn, sondern an einem hohen runden
Felsbogen über den Gletscherbäche stürzen,
ein Öschinenthal ohne See, ein nach vorn gerückter
Brunnithalkessel. Die Wasser sammeln sich zu einem Bach, dem
Fätschbach und jetzt haben wir wieder ein
Thalgewässer und einen Begleiter. Wir stehen im Alpensaal,
grün das Parket und Brustgetäfer, gelbgrau die
Wände und silbern der Skulpturenschmuck unter der blauen
Decke; dann treten wir aus der schattigen Kühle und durch den
Wald hinaus in die offene Halle, in den langen Urnerboden. Wir
begreifen, dass die Heerden der Ennetbirgler von selber den Weg aus den
steinigen Höhen in diesen reichen Grund gefunden haben und wie
ihre Hirten ihn, einmal in Besitz genommen, nicht mehr lassen wollten.
Nur der allmälig von unten herauf kommende Druck hat sie
gehindert, noch weiter gegen die Linth hin vorzudringen."
"Alljährlich im Frühjahr, wenn das erste Grün auf dem Boden erscheint, noch bevor der Klausen schneefrei ist, ziehen die Urner, vornehmlich die Schächenthaler, es hat aber jeder Urner das Recht, auf Ennetmärch zu sömmern - mit Kind und Kegel hinüber in ihre Alp. Um Johanni herum, wenn das Gras gewachsen ist, folgt das Vieh, das noch zurückgebliebene Volk, Obrigkeit, Schullehrer und Kapllan; dann beginnt das herrliche Alpenleben. So viel Vieh einer hat, immerhin nicht über 30 Stück Grossvieh, kann er auf die gemeinsame Weide treiben, gegen eine geringe "Auflage" pro "Haupt". Aus dem Allmeindboden kann er sich ein Stück auswählen, einzäunen und dreissig Jahre lang als eigen behalten, dann fällt es wieder an die Allmeinde zurück. Jetzt freilich ist diese Ordnung aufgehoben. Man gedachte auf diese Weise den Boden allmälig zu bessern, urbar zu machen, merkte aber, dass man dabei das übrige Weideland, wegen Entzug des Düngers, verschlechterte. Ein solches Stück Land hiess eine Rüti, oder wenn Kartoffeln gepflanzt wurden, Garten."
"Zur
Rüti gehört ein Häuschen und ein Stall und
beide zusammen bilden die sog. "Rustig". Ob in diesem Wort "Rustig"
nicht das lateinische rusticus steckt? Holz bekommt der Urner aus dem
Korporationswald, für Bauholz bezahlt er 50 Ct. Pro Stamm,
Milch geben die Kühe, Luft und Sonne der Herrgott; wie solls
da dem Urner nicht wohl sein auf dem Boden? Im Hochsommer zieht man auf
die "Ausstäfel", die obern Alpweiden, dann nochmals kurze Zeit
auf den Boden zurück, und am Verenatag, anfangs September,
folgt der grosse Markt, und der "Verenasonntag" mit der
Älplerkirchweih. Da sitzen die Sennen breit hinter dem Tisch,
essen Schaffleisch und thun sich mit der Gabel Bescheid, trinken ihren
"Italiener", aber auch schwarzen Kaffee und Schnaps, tanzen und jubeln,
schelten und streiten, wie's ihnen grad ums Herz und den Geldbeutel ist
und die Käse gegolten haben. Wenn's mit der Weide fertig ist,
die Tage kühler werden und der Schnee hereinhängt,
dann zieht Vieh und Menschenkind wieder ab, über den Klausen,
der Winterwohnung zu. Nur wenige Familien bleiben auf dem Boden, um
dort zu überwintern, jährlich mehr, wie es wohnlicher
wird durch bessere Bauten, während in früheren Zeiten
nur der "Spittelrütener" das Recht hatte, den ganzen Winter
dort zu verbleiben, wogegen er das Klausenchäppeli zu
unterhalten und sein Haus auch für andere offen zu halten
hatte. Also ein Art Hospiz oder Spittel."
"Wohl mag
hie und da einer, wenn er über den Klausen heimwärts
zieht, sehnsüchtig noch einmal zurückblicken, ob er
auch wiederkehren möge?
In alten Zeiten machte das Land einen Bittgang über den Klausen auf die Alp Urnerboden, auf dies Gemeinmark, die kurzweg "auf der Marken", dann "auf der Märch" genannt wurde, als feierlicher Flurumgang, alter alamannischer Übung gemäss; später übernahmen die Kirchgemeinden Spiringen und Unterschächen diesen Bittgang." 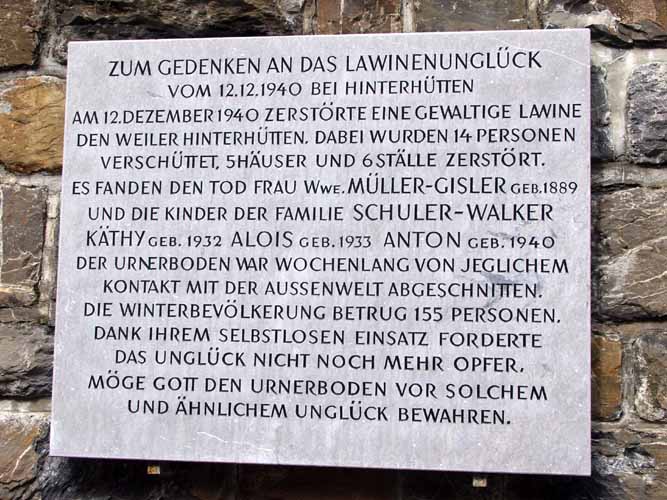 "Die
ehemaligen Steitigkeiten zwischen Urnern und Glarnern nahmen ihr Ende,
nachdem beide von einem gemeinsamen Feinde, von Östreich,
bedrängt wurden. Zunächt wollten sich die Urner, als
ein östreichischer Angriff auf die Waldstätte drohte,
gegen die noch nicht mit ihnen verbündeten, sonder unter
Östreich stehenden Glarner sichern, die ihnen über
den Klausen hätten gefährlich werden können;
sie schlossen daher am 7. Juli 1315 "am niedersten Wang", am Ausgang
des Urnerbodens gegen Glarus hin, einen Waffenstillstand mit den
Glarnern, dem dann am 4. Juli 1352 ein förmlicher Bund folgte,
so dass Uri nun von der Klausenseite her gegen Östreich sicher
war. In diesem Bunde wurde auch bestimmt, dass in Streitfällen
zwischen Uri und Glarus die Boten und Schiedsrichter auf dem Urnerboden
zusammentreten sollten."
 "Einmal in
gemeinsamer Gefahr geeint, hielten Urner und Glarner alsdann wacker
zusammen. Freilich, wenn auch politisch verbündet, hatten sie
doch noch etwas einen Spahn miteinander, dafür aber auch
wieder fröhliche Zusammenkünfte und lustige
Schiesset; der Kampf war mehr ein wirtschaftlicher; allmälig
sind sie sich gerade in diesem wirtschaftlichen Verkehr, in Handel und
Wandel immer näher getreten, und jetzt ist der Urnerboden
gewissermassen ein Urnerthal im Glarnerland. Die Strasse bildet das
Band und vermittelnde Glied; Urner und Glarner wetteifern nun, dieses
Thal zu heben und Nutzen aus ihm zu ziehen. Schon sieht es heute anders
aus; infolge der Entwässerungskanäle, die der
Strassenbau mit sich brachte, beginnen sumpfige Flächen zu
trocknen; mit der Zeit wird wohl auch der ungezähmte Bach
korrigiert, werden Hänge von Schutt gereinigt und teilweise
aufgeforstet sein, und nach einem Menschenalter wird man kaum die Alp
von früher wiedererkennen."

"Hat der
Bund beim Bau der Strasse so wacker mitgethan, so wird er auch bei den
weitern Verbesserungswerken helfen, zu denen die Eröffnung der
Strasse den Impuls gegeben."
"Mittlerweile haben wir die Kehren von Vorfrutt, die wildeste Partie des ganzen Strassenzuges, längst hinter uns gelassen; wir stehen im ebenen Grund, unter den aufstrebenden Orgelpfeifen der Jägernstöcke, am violettgrünen Wängiswald, über den ein weisser Firn schimmert. Durch zerstreute Hütten zieht sich schnurgerade die Strasse, um zunächst an einen breiten Hügel zu stossen, aus dessen Tannen wieder ein Kapellenturm ragt, in dessen Nähe aber auch wieder ein Wirtshaus oder eine ganze Gruppe von solchen zur Einkehr ladet. Wagen stehen herum und die Post spannt frische Pferde vor. Postbureau Urnerboden, was sagen bloss diese zwei Worte!"
"Anderthalb
Stunden lang ist dieser Boden, eben wie ein Tisch; die Sonnenseite
baumlos, das Feld der Lawinen und Schlipfe -, die Schattenseite mit
dichtem Wald bekleidet. Wo's sicher ist vor Lawinen, Rüfen und
Steinschlag, schmiegen sich die Hüttchen zusammen, ganze
Dörfer sind's drinnen lebten und leben die Menschen
Jahrhunderte, drum lagert das Vieh nach dem Melken. Klare
Quellbäche, wie für Forellen geschaffen,
durchfliessen die Weiden, und wie ein sittiger Knabe zieht der
Fätsch durch den Grund, wenn er nicht
überschäumt in der Hitze der hochstehenden Sonne oder
beim schwarzen Gewitter seine Geschiebsmassen schleppt, hoch oben von
den Moränen, von denen sich der Gletscher zurückzog."
"Vorn am Boden legt sich noch einmal ein Hügel mitten ins Thal; da ist die Grenze. Vom Hange herunter fliesst der "Scheidbächli", der alte "Ursinbach" der Urkunden. Eine steinerne Brücke mit einem stattlichen Grenzstein erhebt sich, wo früher ein bescheidenes Holzbrückli und ein einfaches Gatter, das "Urnerthürli", stund. Da liess einst der arme Glarner Läufer sein Leben."
"Viel ward
hier gestritten. Des vielen Streites müde, erzählt
die Sage, kamen endlich Urner und Glarner überein, die Grenze
freundnachbarlich festzusetzen. An einem bestimmten Tage sollte von
Altdorf und Glarus je ein Läufer aufbrechen und dem Klausen
zueilen; wo sie zusammentreffen, solle die Grenze sein. Das Zeichen des
Aufbruchs sollte der erste Hahnschrei geben, und Urner wachten in
Glarus und Glarner in Altdorf, dass es recht dabei zugienge. Die
Glarner fütterten ihren Hahn reichlich, dass er am Morgen
wacker krähe, die Urner aber liessen den ihrigen fasten, damit
ihn der Hunger früh wecke. Früh krähte er,
als der Morgen kaum dämmerte; der in Glarus aber schlief fest
in den Tag; bangend umstand ihn die Gemeinde, manch' Wort und Ratschlag
hörte der wartende Läufer. Endlich ergeht so ein
träger Ruf und der Läufer springt auf, das drei
Stunden lange Thal hinein und dann die stotzige Halde hinan, er
läuft sich das Herz aus dem Leibe. Aber o weh; kaum ist er ein
Stück weit gestiegen, so kommt ihm mit Jauchzen der Urner
Läufer entgegen, so weit herunter, wie kein Urner im Traum je
gedacht hätte, dass man vom Glarnerland bekomme. "Lass mir
noch ein Stück", bat der Glarner; "Keinen Zoll breit"
erwiderte der Urner. "Nur soweit ich dich noch aufwärts zu
tragen vermag." "Gut, soviel sollst du noch haben." Und der Glarner
trug den Urner noch hinauf bis zu jenem Bächli; da sank er tot
nieder, und hier wurde die Grenze."
 "Der
Fätschbach, der wie zögernd dahinfliesst, aus dem
schönen Thal zu scheiden, beginnt wieder zu eilen und bald
stürzt er donnernd ab in die Tiefe; über vier grosse
Stufen eilt er herunter, jede mit einem Wasserfall
schmückend."
"Es öffnet sich ein neuer Ausblick; gibt's wieder einen Urirothstock zu schauen? Verwundert sehen wir, wie der flache Rücken des Kammerstockes sich verwandelt; er beginnt uns die Gibelseite zu zeigen, kühne Felszacken ragen an seinen Flanken empor. Dann fällt der Blick ins Thal, auf herrliche grüne Auen, drin wie Rosenknöpfe farbige Häuschen stehen, auch ein helles Haus, das muss das Schulhaus sein. Ja, wir sind in Glarus, einem schulfreundlichen Land; wo du auf Bergeshöhe einen weissen Punkt siehst, da ist ein Schulhaus; "Hochschulen" nennen sie's. Bald erscheint tief unten am Bergeshang eine einsame Kirche, dann eine zweite in einer Häusergruppe: das ist Linthal. Buchenwald umfängt uns wieder, farbiges Gesträuch, hohe Königskerzen und Weiderosen schmücken ihn; Bergwiesen dehnen sich. Wir treten aus der Alp und folgen neugierig der Strasse mit ihren hellen Wehrsteinen und Mauern. Sie wendet sich ab, welch' Blick nach dem Thalschluss! Das ist kein Saal und kein Münster, das ist ein Dom. Hoch auf ragt der gewaltige Vierungsturm, der Selbsanft, in seiner edlen Form; über seine Schultern blicken ihm wie Silberdächer die breiten Eisrücken der Plattalva und des Bifertenstockes; rechts schliesst die nun kühn aufgeschossene Pyramide des Kammerstockes das Bild. Will die Klausenstrasse noch all' ihre Schönheit zusammenfassen in einem Schlussbild? Haben wir nicht schon des Grossen genug geschaut?" "Der Tödi zeigt sich noch nicht, nur unten rauscht mächtig die Linth und erzählt uns, dass sie von ihm komme. Links vom Selbsanft gähnt eine Schlucht, das tiefe Limmerntobel; da kann man, wenn Lawinen den Bach überbrücken, nach Bünden hinüber. Über der Terrasse der Baumgartenalp hebt sich der sagenumsponnene Scheidstöckli, bis wohin der Jäger darf, wenn er nicht freveln will im Freiberg. Dann senkt sich der Grat zum Bächlikamm und den Zacken und der runden Form des Kilchenstockes, wo der Mensch Kampf führt gegen die Elemente und die Runsen eindämmt und die Lawinen verbaut. Nur ein Riss geht durch, da hat auch der Kaiser sein Recht verloren. Weiter breitet sich der Saasberg mit der lieblichen Kuppe der Schönau; dann schliesst der massige Schild den Rahmen. Jetzt, bei einer neuen Wendung der Strasse, sehen wir ins Thal hinab; wie an eine Schnur reiht sich Dorf an Dorf; in braune und graue Häuser hineingesetzt sind grosse helle Gebäude; das sind Fabriken. Wie stattlich erscheint Linthal, ein Industieflecken der Tiefebene, hineingesetzt unter die Felsen und Lawinen der Alpen!" ... |
| HERZLICHEN DANK FÜR DEN BESUCH UND IM VORAUS AUCH FÜR EIN FEEDBACK! EVELYNE SCHERER | Kontakt |